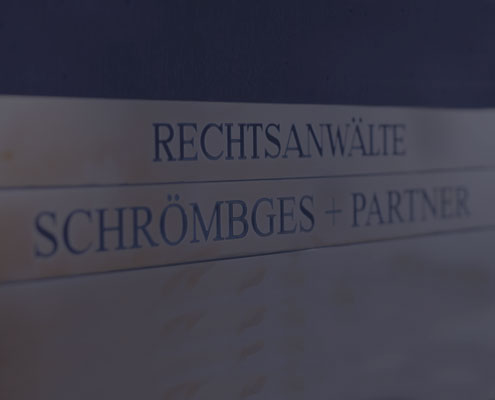https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/364gyn6m1fh Zur mündlichen Verhandlung vor dem EuGH in Sachen C-124/20 – Auslegung der Blocking-VO (EG) Nr. 2271/96
Der EuGH hat heute in der Rechtssache C-124/20 zur Frage mündlich verhandelt, wie die Blocking-VO (EG) Nr. 2271/96 anzuwenden ist, wenn die Deutsche Telekom GmbH Geschäftsbeziehungen mit unter das Iran-Sanktionsregime der USA fallenden Personen – hier die Hamburger Niederlassung der Bank Melli Iran – beendet.
Während der fast 3-stündigen, lebhaften Verhandlung hat sich herausgestellt, dass jedenfalls die Europäische Kommission der von uns vertretenen Auffassung folgt, wonach ein Nachkommen i. S. d. Art. 5 Abs. 1 Blocking-VO (also ein verbotenes Befolgen der Sanktionen) schon dann anzunehmen bzw. zu vermuten ist, wenn es den erklärten Zielen der Iran-Sanktionen entspricht, ohne dass deren Tatbestände tatsächlich erfüllt sein müssten.
https://musiciselementary.com/2024/03/07/ryxw4as9es Art. 5 Abs. 1 Blocking-VO begründet Beweislastumkehr zulasten von EU-Unternehmen
Bislang wird Art. 5 Abs. 1 der Blocking-VO so interpretiert, dass er auf eine Tatsachenfrage hinausläuft, im vorliegenden Fall also der Telekom nachzuweisen wäre, ob die ordentliche Kündigung von Telekommunikationsverträgen auf kommerziellen Geschäftserwägungen beruht oder durch die US-Rechtsvorschriften bedingt sein könnte. Das ist im Einzelfall schwierig und lässt Art. 5 Abs. 1 Blocking-VO ganz weitgehend leerlaufen.
Das aber ist mit der vom Gerichtshof bereits festgestellten Notwendigkeit unvereinbar, die Blocking-VO so auszulegen, dass ihre volle Wirksamkeit gewährleistet ist. Deshalb muss der Blocking-VO eine widerlegliche Vermutung innewohnen, nach der bei entsprechenden Sachverhalten allein die Existenz der US-Strafsanktionen zur gemäß Art. 5 Abs. 1 Blocking-VO verbotenen Befolgung führt. Daraus folgt eine Beweislastumkehr zu Lasten des betroffenen EU-Unternehmens (hier der Telekom), sodass dieses nachweisen muss, dass die fragliche Geschäftshandlung nicht auf dem Sanktionsregime der USA beruht.
Die Kommission legt der betroffenen Person hier eine Begründungspflicht auf, wonach diese darzulegen hat, dass das Befolgen, hier die Kündigung, nicht überwiegend den US – Strafsanktionen geschuldet ist. Es ist auch nicht erkennbar, was angesichts des Art. 5 Abs. 1 Blocking-VO dagegensprechen sollte: ohne Darlegung der Gründe kann nicht beurteilt werden, ob das fragliche Verhalten verbotswidrig beeinflusst ist
Nur durch eine solche Auslegung kann das Ziel der Blocking-VO (das auch allgemeines Ziel der EU ist), den freien internationalen Handels- und Kapitalverkehr umfassend zu schützen, wirksam verwirklicht werden. Diese Ziele, aber auch die Souveränität der EU und ihrer Mitgliedstaaten, sind indes bereits durch den „Terror“ in Gefahr, der von drittländischen Strafsanktionen ausgeht, die per se auf eine Verhaltensbeeinflussung von Unionsbürgern im Hoheitsgebiet der EU abzielen. Solche Strafsanktionen nehmen die Interessen der EU und der betroffenen Wirtschaftsteilnehmern quasi in Geiselhaft. Hier gilt also das Motto: Wehret den Anfängen!
Der allgemein geltende Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sowie die einschlägigen Grundrechte der EU-Unternehmen werden durch die Möglichkeit der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gewahrt
Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des so verstandenen Verbots, das US-Sanktionsregime zu befolgen, sind nicht angebracht. Denn auch wenn Art. 5 Abs. 1 Blocking-VO ein solches Befolgen verbietet, so kann es doch nach Art. 5 Abs. 2 von der Europäischen Kommission in einem Genehmigungsverfahren erlaubt werden, falls eine Abwägung der beteiligten Interessen dies gebietet. Art. 5 Abs. 2 ist damit eine Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, auch im Hinblick auf Art. 10 und 52 der Charta der Grundrechte der Union. Zwar mag das Befolgen der fraglichen Rechtsakte verboten sein. Es kann aber dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz widersprechen, wenn die damit verbundenen Schäden für die betroffene Person und/oder die Union übermäßig sind. Freilich muss das betroffene EU-Unternehmen den Antrag bei der Kommission auch stellen, andernfalls begibt sich der Betroffene des Verhältnismäßigkeitsschutzes, und es verbleibt bei dem Verbot.
Es bleibt nunmehr abzuwarten, wie sich der Generalanwalt und schließlich der EuGH selbst in der Sache positionieren.
Ansprechpartner